Freistellung in Österreich: Pflicht, Chance oder Risiko für Arbeitgeber?
Ob Pflegefreistellung, Mutterschutz oder der oft heikle Sonderfall einer Freistellung nach einer Kündigung – der Begriff „Freistellung“ sorgt im Arbeitsalltag häufig für Verunsicherung.
Kein Wunder: Im österreichischen Arbeitsrecht fehlt eine einheitliche Definition.
Statt Klarheit gibt es eine Vielzahl an Szenarien, Regelungen und rechtlichen Grauzonen.

Doch genau das macht das Thema für Arbeitgeber so relevant. Denn wer die Unterschiede nicht kennt, riskiert rechtliche Stolperfallen – und im schlimmsten Fall teure Konsequenzen.
In diesem Beitrag erfahren Sie:
- Was eine Freistellung rechtlich bedeutet
- Welche Arten der Freistellung in Österreich vorkommen
- Was Sie als Arbeitgeber unbedingt beachten müssen
Inhaltsverzeichnis
1. Definition: Was ist eine Freistellung in Österreich?
Unter einer Freistellung versteht man die vorübergehende Befreiung von der Arbeitspflicht, während das Dienstverhältnis aufrecht bleibt. In dieser Zeit ist der Arbeitnehmer von der Pflicht zur Arbeitsleistung entbunden – entweder auf Initiative des Arbeitgebers, in beidseitigem Einvernehmen oder aufgrund gesetzlicher Regelungen.
2. Welche Formen der Freistellung gibt es?
Je nach Anlass und rechtlicher Grundlage kann eine Freistellung sehr unterschiedlich ausgestaltet sein – insbesondere in Bezug auf den Willen der Vertragspartner, die Vergütung und die Widerruflichkeit.
2.1. Einseitig, einvernehmlich oder gesetzlich geregelte Freistellung
- Einseitige Freistellung:
Diese erfolgt durch den Arbeitgeber allein, z. B. während einer Kündigungsfrist. Der Mitarbeiter wird von der Arbeitspflicht entbunden, das Arbeitsverhältnis bleibt jedoch bestehen. - Einvernehmliche Freistellung:
Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbaren gemeinsam eine Freistellung, etwa für einen unbezahlten Urlaub oder eine geplante Auszeit. - Freistellung aufgrund gesetzlicher Schutzbestimmungen:
Bestimmte Situationen, wie der Mutterschutz, führen automatisch zu einer Freistellung – unabhängig vom Willen der Vertragspartner.
2.2. Bezahlte und unbezahlte Freistellung
- Bezahlte Freistellung:
Der Arbeitnehmer erhält weiterhin sein volles Gehalt, obwohl keine Arbeitsleistung erbracht wird. Typische Beispiele sind der Papamonat oder die Pflegefreistellung. - Unbezahlte Freistellung:
Hier ruht die Vergütungspflicht – etwa bei einer privaten Auszeit, längeren Reisen oder Weiterbildungen, die außerhalb des betrieblichen Interesses liegen.
2.3. Widerrufliche und unwiderrufliche Freistellung
- Widerrufliche Freistellung:
Der Arbeitgeber behält sich vor, den Arbeitnehmer jederzeit wieder zur Arbeit zu rufen – zum Beispiel bei unvorhergesehenem Personalbedarf. - Unwiderrufliche Freistellung:
Diese gilt für einen festgelegten Zeitraum und kann nicht einseitig aufgehoben werden. Besonders häufig kommt sie im Rahmen einer Kündigung zum Einsatz, da sie Planungssicherheit für beide Seiten schafft.
Freistellungen, Urlaube und Abwesenheiten – alles an einem Ort, jederzeit im Griff.
Mit unserer digitalen Lösung verwalten Sie alle Abwesenheiten Ihrer Mitarbeiter klar, einfach, schnell, transparent und fehlerfrei.
Jetzt Demo anfordern und spürbar Zeit im HR-Alltag sparen.
3. Typische Gründe für eine Freistellung von der Arbeit
Ob gesetzlich geregelt, betrieblich notwendig oder persönlich gewünscht – Freistellungen begegnen Arbeitgebern in vielen praktischen Alltagssituationen.
Typische Anlässe sind zum Beispiel:
- eine Freistellung während der Kündigungsfrist,
- ein Sabbatical oder eine geplante Auszeit,
- familiäre Verpflichtungen wie Pflege oder Geburt eines Kindes,
- betriebliche Gründe wie Auftragsmangel oder Umstrukturierungen,
- oder der Wunsch nach Weiterbildung.
Je nach Ausgangslage gelten unterschiedliche rechtliche Rahmenbedingungen – von gesetzlich verpflichtend bis freiwillig vereinbart.
Im Folgenden finden Sie einen kompakten Überblick über die häufigsten Freistellungsarten und ihre rechtliche Einordnung:

Hier ein Überblick über die häufigsten Gründe:
Freistellung nach Kündigung
Freistellung nach Kündigung
Wird in Österreich ein Arbeitsverhältnis gekündigt, kann der Arbeitgeber den Arbeitnehmer bis zum Ende der Kündigungsfrist einseitig freistellen – unter Fortzahlung des Entgelts. Diese sogenannte bezahlte Freistellung dient häufig dazu, Resturlaub oder Überstunden abzubauen oder sensible Übergaben zu vermeiden. Eine einvernehmliche Regelung nach einer Kündigung durch den Arbeitnehmer ist ebenfalls möglich, insbesondere wenn beide Seiten an einem geordneten und konfliktfreien Austritt interessiert sind.
Pflegefreistellung
Pflegefreistellung
Arbeitnehmer haben einen gesetzlichen Anspruch auf Freistellung zur Pflege eines erkrankten Kindes oder nahen Angehörigen – bis zu einer Woche pro Arbeitsjahr (§ 16 UrlG).
Einvernehmliche Freistellung
Einvernehmliche Freistellung
Wenn private Gründe wie ein Sabbatical, längere Reisen oder persönliche Projekte anstehen, kann zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine freiwillige Freistellung vereinbart werden.
Papamonat / Väterkarenz
Papamonat / Väterkarenz
Nach der Geburt eines Kindes kann ein Vater für einen Monat freigestellt werden – eine wichtige Zeit für Bindung und Unterstützung im Familienalltag. Er erhält in dieser Zeit kein Gehalt vom Arbeitgeber, ist aber versichert und kann eine staatliche Geldleistung für die Dauer beantragen.
Mutterschutz
Mutterschutz
Acht Wochen vor und nach der Geburt gilt ein gesetzlich geregeltes Beschäftigungsverbot zum Schutz der Gesundheit von Mutter und Kind. In dieser Zeit erhält die werdende Mutter kein Gehalt, sondern mit Antragsstellung das sogenannte Wochengeld von Ihrer Krankenkasse. Der Urlaubsanspruch baut sich aber während des Mutterschutzes weiter aliquot auf.
Freistellung für Betriebsratsmitglieder
Freistellung für Betriebsratsmitglieder
Je nach Betriebsgröße können Mitglieder des Betriebsrats vollständig oder teilweise von der Arbeit freigestellt werden, um ihre Aufgaben wahrzunehmen und erhalten dabei das volle Entgelt weiter bezahlt.
Freistellung für Weiterbildung
Freistellung für Weiterbildung
Mitarbeitende können sich für eine berufliche oder persönliche Weiterbildung freistellen lassen – mit entsprechender freiwilliger Vereinbarung und unter bestimmten Voraussetzungen.
Freistellung bei aufgebrauchtem Urlaubsanspruch
Freistellung bei aufgebrauchtem Urlaubsanspruch
Sind alle Urlaubstage verbraucht, kann bei Zustimmung des Arbeitgebers eine zusätzliche unbezahlte Freistellung erfolgen – zum Beispiel für eine notwendige Auszeit.

Lesetipp
Auch wenn Freistellungen nicht im Arbeitszeitgesetz geregelt sind, lohnt sich ein Blick darauf – etwa im Hinblick auf Arbeitszeitmodelle und betriebliche Planung.
Zum Artikel: Arbeitszeitgesetz in Österreich
4. Checkliste für den Arbeitsalltag
Damit Sie als Arbeitgeber schnell erkennen, welche Freistellung in welcher Situation relevant ist, haben wir die häufigsten Gründe übersichtlich in einer kompakten Checkliste zusammengefasst.
Diese Übersicht zeigt Ihnen auf einen Blick:
- Ist die Freistellung gesetzlich verpflichtend oder freiwillig?
- Wer entscheidet über die Freistellung – Arbeitgeber, Arbeitnehmer oder das Gesetz?
- Wird die Freistellung in der Praxis üblicherweise bezahlt oder nicht?
So behalten Sie im Alltag den Überblick – und können bei Bedarf fundierte und rechtssichere Entscheidungen treffen:
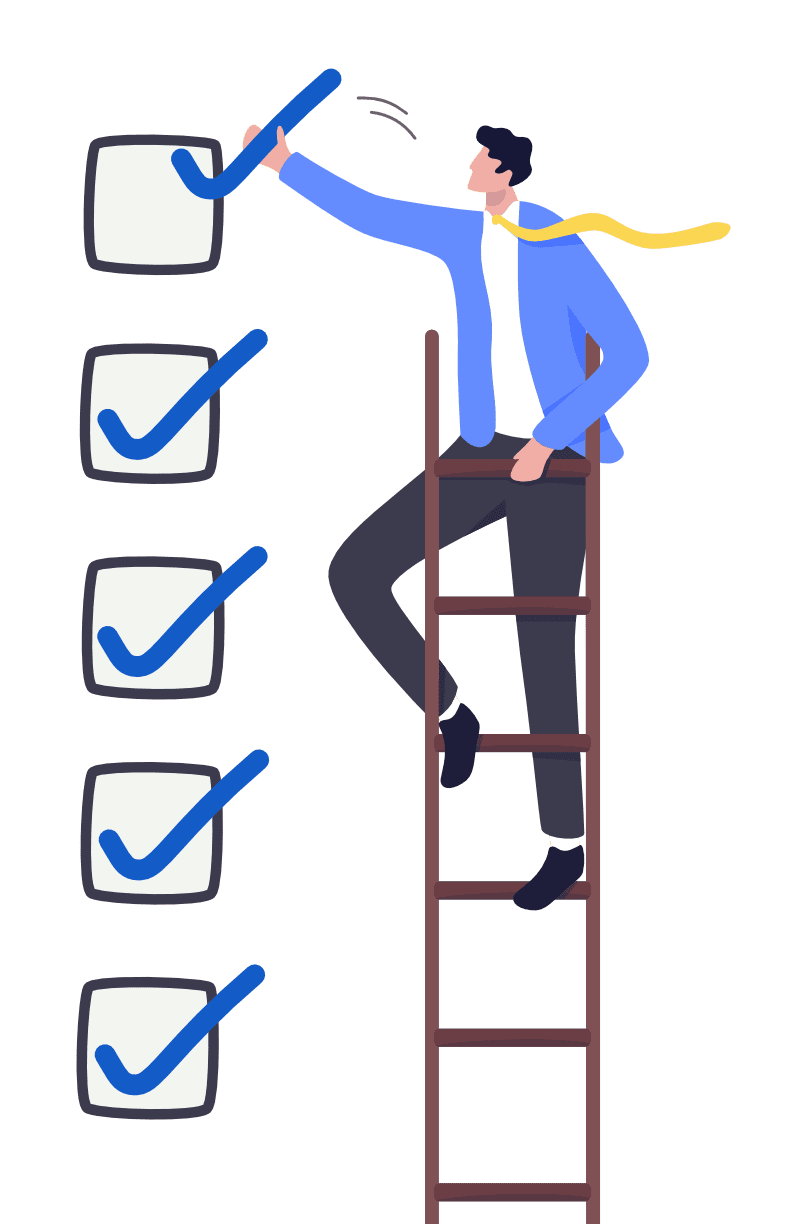
Diese Checkliste eignet sich ideal zur schnellen Orientierung – etwa im HR-Alltag oder bei der Erstellung interner Prozesse zur Freistellungsregelung.

Tipp
Ergänzen Sie interne Richtlinien mit klaren Vorlagen für freiwillige Freistellungen – das schafft Transparenz und reduziert Rückfragen.
5. Abgrenzung zu Sonderurlaub und gesetzlichen Dienstverhinderungen
Im alltäglichen Sprachgebrauch werden Freistellung und Sonderurlaub häufig gleichgesetzt – rechtlich handelt es sich jedoch um unterschiedliche Konzepte:
- Freistellung ist ein Oberbegriff für die temporäre Befreiung von der Arbeitspflicht – mit oder ohne Gehalt. Sie kann gesetzlich geregelt, kollektivvertraglich vereinbart oder individuell beschlossen werden.
- Sonderurlaub bezeichnet im engeren Sinn bezahlte Dienstverhinderungen aus persönlichen Gründen, wie z. B.: Hochzeit, Geburt eines Kindes, Sterbefälle oder Wohnungswechsel.
Einige dieser Gründe sind gesetzlich verankert, weitere können im Kollektivvertrag geregelt sein – oft großzügiger als das Gesetz. Dort finden sich häufig zusätzliche Ansprüche auf bezahlte Dienstverhinderung, etwa bei Gerichtsterminen oder Notfällen in der Familie.

Tipp
Eine umfassende Übersicht zu diesen Fällen finden Sie im Beitrag Sonderurlaub in Österreich – Anspruch, Dauer & Bezahlung.
6. Was Arbeitgeber bei einer Freistellung beachten sollten
Damit eine Freistellung rechtssicher, fair und transparent bleibt, sollten Arbeitgeber einige grundlegende Punkte beachten:
1. Schriftliche Vereinbarung treffen
Zeitraum, Beginn und Ende der Freistellung sollten immer schriftlich festgehalten werden. Das schafft Klarheit für beide Seiten und beugt Missverständnissen vor.
2. Rechtsgrundlagen prüfen
Je nach Fall können Gesetz, Kollektivvertrag oder Betriebsvereinbarung besondere Regelungen enthalten. Ein kurzer Blick in die jeweiligen Bestimmungen lohnt sich, um rechtliche Risiken zu vermeiden.
3. Bezahlung eindeutig regeln
Ob die Freistellung bezahlt oder unbezahlt erfolgt, sollte klar vereinbart werden. So lassen sich spätere Diskussionen oder Unklarheiten verhindern.
4. Betriebsrat frühzeitig einbinden
Wenn ein Betriebsrat besteht, sollte er rechtzeitig informiert werden – insbesondere bei einseitigen Freistellungen. Das fördert Transparenz und stärkt das Vertrauen im Unternehmen.
5. Abgrenzung zu Sonderurlaub beachten
Freistellung ist nicht gleich Sonderurlaub. Eine klare Kommunikation hilft, Verwechslungen bei Anspruch, Dauer und Bezahlung zu vermeiden.
6. Besonderheiten bei Kündigungen berücksichtigen
Gerade im Rahmen einer Kündigung ist eine präzise Regelung entscheidend. Wichtig ist festzulegen, ob die Freistellung widerruflich oder unwiderruflich erfolgt und ob sie mit oder ohne Entgeltfortzahlung verbunden ist. Das sorgt für Sicherheit in einer sensiblen Phase.
Kurz gesagt: Klare Regeln, saubere Dokumentation und offene Kommunikation sind der Schlüssel zu einer rechtssicheren und fairen Freistellung.
